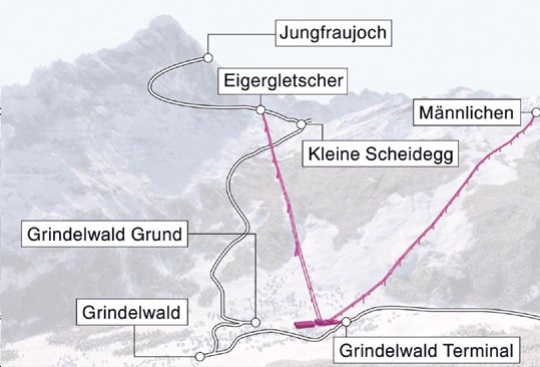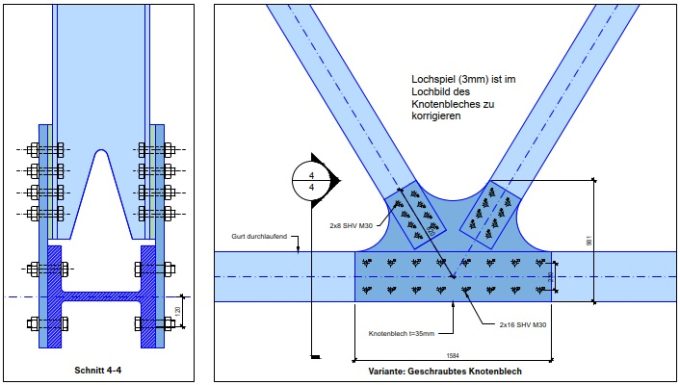Die Gebäudetechnik befindet sich in einem strukturellen Wandel. Das bestätigt auch Stefan Schaffner, General Manager von Johnson Controls Building Technologies & Solutions (BT&S) Schweiz. Wir haben uns mit ihm über die neuen Herausforderungen unterhalten.
Herr Schaffner, Sie haben die Aufgabe als General Manager von Johnson Controls BT&S in der Schweiz vor mehr als einem Jahr übernommen. Welches Fazit ziehen Sie nach dieser Zeit?
Stefan Schaffner: Ein sehr positives – trotz und vielleicht sogar wegen der Herausforderungen, die ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern zu überwinden hatte. Beherrschend war natürlich die Pandemie – für mein Team wie für das Unternehmen, im Privaten wie im Geschäftlichen. Und über allem steht der Klimawandel, der uns auch noch lange nach Covid-19 beschäftigen wird – im Positiven wie im Negativen. Es war sicherlich eine extrem herausfordernde Zeit, in der viele unserer Sicherheiten weggebrochen sind. Dennoch ist es gelungen, Johnson Controls neu auszurichten und weiter voranzubringen – als innovativen und zukunftsorientierten Lösungsanbieter und natürlich als attraktiver Arbeitgeber für junge, motivierte Menschen in der Schweiz.
Was hat diesen Wandel aus Ihrer Sicht so notwendig gemacht?
Dank der Neuorganisation und der bereits vor einiger Zeit abgeschlossenen Fusion mit Johnson Controls sind wir nun in der Lage, ein breites, einzigartiges Angebot aus Gebäudeautomation, Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC), Sicherheit und Brandschutz anzubieten. Nun können wir uns neben dem ursprünglichen Fire-and-Security-Geschäft besonders als innovativer Vorreiter präsentieren und Komplettlösungen anbieten, die sich aus unserem gesamten Leistungsportfolio zusammensetzen. Die Geschäftsbereiche HVAC, Gebäudeautomation sowie Fire and Security arbeiten nun Hand in Hand zusammen, um Gebäude optimal zu vernetzen und leistungsfähiger zu machen. Darauf mussten natürlich auch unsere internen Prozesse und Portfolios abgestimmt werden. Und das haben wir geschafft: Wir positionieren wir uns nun als leistungsfähiges und marktführendes Unternehmen mit einer in sich stimmigen Strategie und hoher Lösungskompetenz.
Welchen Einfluss hat noch andauernde Pandemie auf die Geschäfte von Johnson Controls?
Auch hier fällt die Bilanz insgesamt positiv aus. Glücklicherweise hat unser internes Schutzkonzept sich bewährt, und wir konnten eine Ausbreitung des Corona-Virus im Unternehmen aktiv verhindern. Alle Mitarbeiter sind sehr gut mit diesen Veränderungen umgegangen. Die Krise war und ist natürlich eine enorme Herausforderung – aber sie bietet uns auch neue Chancen und Möglichkeiten. SARS-CoV-2 hat in verschiedenen Bereichen neue Nachfrageimpulse ausgelöst. Die Infektionsresilienz eines Gebäudes ist ein innovatives Geschäftsfeld, das wir mit ebenso innovativen Produkten und Strategien proaktiv angehen.
Wie sieht das konkret aus?
Dafür bieten wir zum Beispiel Software, die ein bestehendes Zutrittskontrollsystem zu einem Hygiene-Kontrollsystem erweitert: Sie erfasst die exakte Anzahl von Personen in einem Gebäude und sichert in Verbindung mit Videokameras, dass ausreichend Abstand gewahrt bleibt. Dasselbe gilt für Luftzirkulation und Luftreinigung: Sie lassen sich ebenso pandemieorientiert steuern und überwachen wie weitere Sicherheitseinstellungen, etwa zur Kontaktverfolgung. Es gibt aber auch neue Produkte, etwa Wärmebildkameras, die die Körpertemperatur der Besucher im Vorübergehen messen.
Sie sprechen da das Konzept Healthy Buildings an. Wie wichtig ist dieser Bereich für die Zukunft der Gebäudetechnik?
Sehr wichtig. Healthy Buildings, das ist heute weitaus mehr als nur gesundes Raumklima, die richtige Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit. Healthy Buildings wird mehr und mehr zur Existenzfrage: Die Pandemie hat das Geschäftsmodell einer ganzen Branche infrage gestellt. Es wird bereits laut über eine dauerhafte Verlegung der Büroarbeit ins Home Office nachgedacht – obwohl das eine ganze Reihe von Problemen mit sich bringt: Der Arbeitsplatz auf dem Sofa oder am Küchentisch ist weder ergonomisch noch sicher vor Hackern. Pandemien wird es immer wieder geben, und zwar in immer kürzeren Intervallen. Die Lösung kann aber auf Dauer nicht sein, vor dem Infektionsdruck auszuweichen. Wir müssen vielmehr die Gebäude gegen Viren härten und damit wieder unbegrenzt verfügbar machen. Nur mit innovativer Hard- und Software können wir den Wert einer Gewerbefläche langfristig sichern.
Sind das reine Insellösungen?
Ganz im Gegenteil! Eingangs habe ich ja erwähnt, dass Pandemie und Klimawandel die entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit sind. Wir merken immer deutlicher, dass wir an die Grenzen unseres Lebensraums stossen. Die jetzige Pandemie wird sicher nicht die letzte sein, und die globale Erwärmung ist eine Herausforderung, die unserer Lebensweise an sich infrage stellt. Beidem können wir nur mit hochgradig vernetzten Strukturen begegnen.
Das müssen Sie jetzt aber genauer erklären
KI-Vernetzung in Gebäuden liefert die Antwort auf entscheidende Fragen, die sich Gebäudebetreiber heute stellen: Wie kombiniere ich die verschiedenen Systeme so, dass sie die maximale Energieeffizienz erreichen? Wie reagiere ich auf sich rasch ändernde äussere Bedingungen, zum Beispiel im dynamischen Pandemiegeschehen? Das Gebäude-Integrationssystem OpenBlue spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Es spannt eine gemeinsame Benutzeroberfläche über Heizung, Klimatisierung, Zugangskontrolle Aufzugssteuerung und vielem mehr, was zeitgemässe Gebäudetechnik ausmacht. Erstmals hat nun der Gebäudeadministrator alles auf einer Konsole im Blick und kann integrativ planen und agieren. Er findet schnell und einfach die energieeffizientesten Kombinationen.

Sie gliedern Ihre Angebote in Branchen: Gewerbliche Gebäude, Industrie und Fertigung, Bildungswesen, Rechenzentren, Transport und Logistik, um nur einige Beispiele zu nennen. Was ist der Vorteil davon?
Auch hier steht der integrative, serviceorientierte Ansatz im Vordergrund. Die Möglichkeiten der Gebäudetechnik sind heutzutage ebenso vielfältig wie die Nutzungsarten. Bei der Planung ist es sinnvoll, nicht in Gewerken zu denken, sondern eben in Branchen. Eine Fabrik braucht eine Heizung, eine Lüftung und eine Zugangskontrolle, genauso wie ein Rechenzentrum. Aber diese Systeme müssen von Branche zu Branche sehr unterschiedlich ausgelegt und dimensioniert werden. Dass dabei verschiedenste Gewerke beteiligt sind, interessiert den Kunden wenig. Er will eine Komplettlösung, die für seine Branche und seine individuellen Bedürfnisse den maximalen Return of Investment bietet. Ebenso integrativ wie in unserer Gebäudeautomations-Software müssen daher im Unternehmen verschiedenste Funktionsbereiche nahtlos und planvoll zusammenarbeiten. Jede Abteilung bringt dabei ihr spezielles Know-how und ihre individuelle Erfahrung ein, versteht sich aber als Teil eines Ganzen, eines individuellen Konzeptes, das immer branchenspezifisch sein muss. Und dieses Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, das gilt auch und ganz besonders für die Gebäudetechnik.
Als Experte für Change Management haben Sie auch grosse internationale Erfahrung, speziell in den USA. Welchen Gewinn ziehen Sie daraus für Ihre Managementaufgabe bei Johnson Controls?
Change-Management, das heisst, wie der Name schon sagt, Veränderung – in den Strukturen, in den Prozessen und nicht zuletzt in den Verhaltensweisen. Und hier weiss ich aus eigener Erfahrung was man neu braucht und was weg kann, was funktioniert und was nicht. Auf der Basis dieses Know-hows habe ich zum Beispiel beschlossen, massiv in den weiteren Ausbau der Serviceorganisation zu investieren. Denn, selbst wenn es abgedroschen klingt: Erfolgreich kann nur sein, wer den Kunden und seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Das muss noch weit über den integrativen, branchenorientierten Ansatz hinausgehen. Insbesondere auf der Informatik-Seite werden wir in den nächsten Monaten gesamtschweizerisch modernste, neue Tools ausrollen. Damit wird der Serviceprozess komplett digitalisiert und die Kommunikation mit unseren Kunden auf ein neues Level gehoben. Die Schweizer Infrastruktur ist perfekt organisiert – und einen genauso perfekten Service erwartet der Kunde hierzulande von seinen Dienstleistern.
Wo sehen Sie die nächsten Entwicklungsschritte von Johnson Controls für die nächsten Jahre?
Die Bereiche Klimaschutz durch Energieeffizienz sowie Healthy Buildings, insbesondere Infektionsresilienz, habe ich ja bereits erwähnt. Ebenso wichtig ist die konsequent kundenzentrierte Ausrichtung. Integrative voll digitalisierte Konzepte werden immer wichtiger – beim Produktportfolio, beim Kundenservice, aber auch betriebsintern. Diesen Weg wollen wir beständig weitergehen. Aber eines ist doch klar: Jedes Unternehmen ist nur so innovativ und serviceorientiert wie seine Mitarbeiter. Nur ein starkes Team ist ein starker Partner für seine Kunden. Deshalb möchte ich gemeinsam mit meinem Führungsteam Johnson Controls als attraktiven Arbeitgeber in der Schweiz weiter voranbringen. Wir bilden nicht nur selbst aus, sondern schaffen Strukturen, die uns aus der Masse hervorheben. Denn im Zeichen des Fachkräftemangels haben junge, gut ausgebildete Talente bei der Jobsuche heute die Qual der Wahl. Und sie schauen sich Arbeitgeber in spe sehr genau an: Nutzt er transparente Kommunikationsprozesse? Sind seine Hierarchien flach? Verfolgt er eine nachhaltige, zukunftsfähige Strategie? Beteiligt er sich proaktiv an der Erhaltung unseres Lebensraumes? Ich bin überzeugt, dass wir für alle diese Fragen überzeugende Antworten haben – heute und in Zukunft.