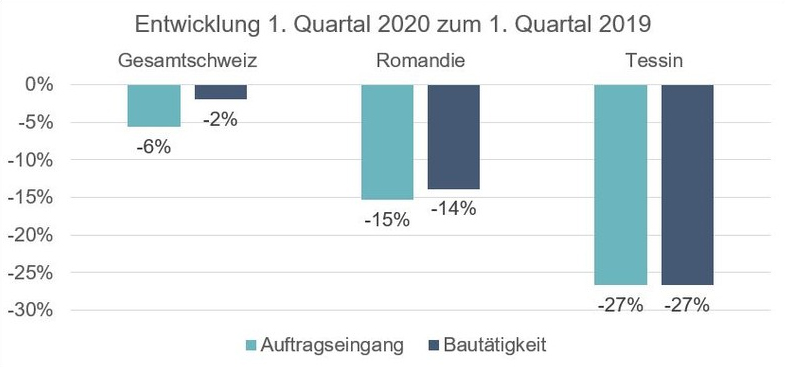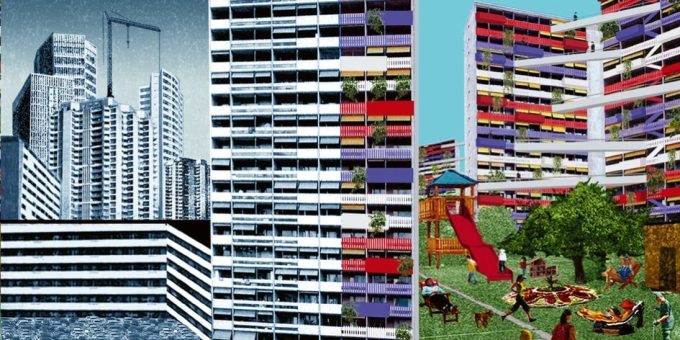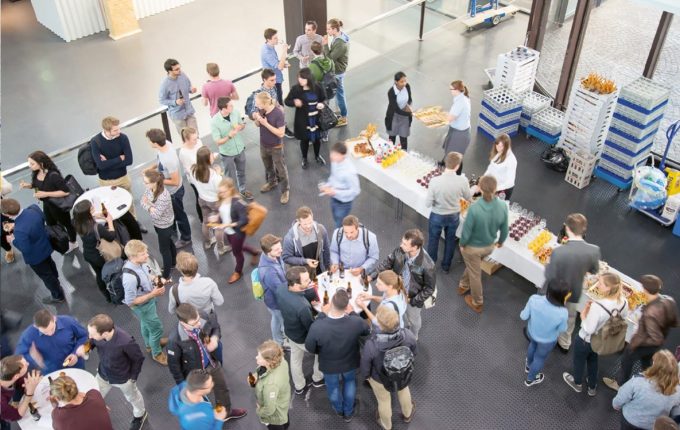Energiewende – nicht ohne Holzenergie
Die Schweiz hat das Pariser Abkommen ratifiziert und damit das Ende der fossilen Energien bis 2050 besiegelt. Ab etwa 2030 darf folglich keine einzige neue Öl- oder Gasheizung mehr installiert werden, wenn man mit einer Lebensdauer der Anlagen von 20 Jahren rechnet. Die Umstellung harzt aber gewaltig. Sie wird 100 Jahre dauern, wenn sie nicht beschleunigt wird.
Der Bundesrat hat bereits am 11. Mai 2016 in seiner Antwort auf eine Interpellation im Nationalrat die Notwendigkeit bestätigt, dass die Begrenzung der Klimaerhitzung auf maximal plus 2°C im Vergleich zu vorindustriellen Werten den kompletten Ersatz fossiler Energien im Heizungsbereich bedingt. Doch immer noch stammt rund ein Drittel aller CO2-Emissionen der Schweiz aus Öl- und Gasheizungen. In kaum einem anderen Land Europas ist der Anteil der Ölheizungen ähnlich hoch, und auch bei Gasheizungen verfolgen zahlreiche Energieversorger immer noch die Strategie «Vorwärts in die fossile Vergangenheit!» Ein grünes Blatt steht hierzulande bekanntlich als Symbol für das Erdgas. Damit wird ein verzerrtes Bild von Natürlichkeit, Sauberkeit, ja gar von Nachhaltigkeit vermittelt. HausbesitzerInnen lassen sich davon blenden und denken nur an Öl oder Gas, wenn sie ihre bestehende Öl- oder Gasheizung ersetzen müssen. Schuld daran sind auch Planer und Installateure, für die der fossile Weg derjenige des geringsten Widerstandes (und schnellsten Profites) ist.
Die Schweiz hinkt hinterher
Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es führt kein Weg an einem viel schnelleren Wechsel auf CO2-neutrale Heizungen vorbei, denn die Schweiz ist heute noch weit vom Zielpfad entfernt. Sollen die Energie- und Klimapolitik glaubwürdig bleiben und endlich erfolgreich werden, braucht es entschiedenes und koordiniertes Handeln sowie den Einsatz aller erneuerbaren Energien. Zu nennen sind Holz-, Sonnen- und Windenergie, Wasserkraft sowie alle Formen der Umweltwärme. Nichts muss grundsätzlich neu erfunden werden, die Technologien der erneuerbaren Energien sind schon heute auf einem guten Niveau und wirtschaftlich immer konkurrenzfähiger.
Wie kann es funktionieren?
Zum Glück gibt es viele gute Beispiele, die man als Vorbild für neue Projekte nehmen kann. Viel Potential schlummert beispielsweise in der Holzenergie. Heute liegen jedes Jahr immer noch 2,5 Millionen Kubikmeter nutzbares Holz brach. Eine Menge, mit der man 500 000 Tonnen Heizöl durch eine einheimische, nachwachsende, klimafreundliche und sichere Energie ersetzen und mehrere hunderttausend Wohnungen heizen kann. Die nachhaltige Nutzung des beachtlichen Potentials schaffte Tausend sichere Arbeitsplätze vor allem im ländlichen Raum. Und sie entlastete die Atmosphäre jährlich um sage und schreibe 1,5 Millionen Tonnen CO2.
Ob eine Zentralheizung für ein einzelnes Gebäude, eine Heizzentrale mit Wärmenetz für ein ganzes Dorf oder gar eine Wärmekraftkoppelung im städtischen oder industriellen Kontext, es gibt praktisch für jede Situation eine massgeschneiderte Holzenergielösung. Kurze Transportwege, wenig graue Energie, eine sichere Versorgung sowie hohe lokale und regionale Wertschöpfung sind Attribute moderner Holzenergieprojekte.
Die von wichtigen Wirtschaftskreisen getragene Wärmeinitiative Schweiz (waermeinitiative.ch) belegt die Machbarkeit der vollständigen Dekarbonisierung des Schweizer Wärmemarktes klar. Die Energie aus dem Wald spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie könnte 2050 einen Fünftel bis einen Viertel des Gebäudeparks heizen. Mehrere Milliarden Franken würden dadurch in unserem Land bleiben und für Arbeit sorgen, statt im Wüstensand oder in den russischen Weiten zu versickern. Die Schweiz sollte sich die Chance der Nutzung ihrer eigenen Energien nicht entgehen lassen. Letztere stehen bereit und ermöglichen die Energiewende. Damit dies in der nötigen Geschwindigkeit passiert, ist die Politik gefordert. Sie muss Rahmenbedingungen schaffen, die für die fossilen Energien möglichst unattraktiv und für die eigenen Energien möglichst attraktiv sind. Dazu gehören einfache Bewilligungsverfahren, substanzielle Förderbeiträge und Rechtssicherheit auf allen Ebenen.
.jpg)