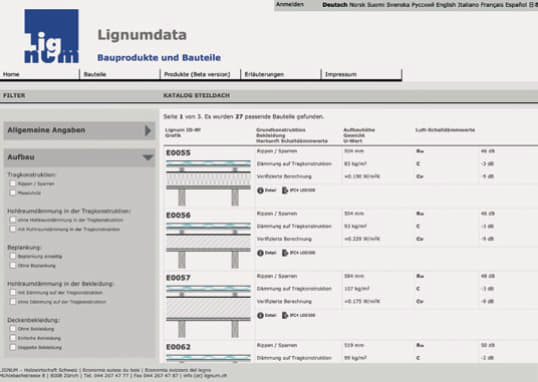«Zimmermann on Tour» 2021
Ein Zimmermann geht auf Tour – am 19. April startet Benjamin Nussbaum seine Reise durch die Schweiz. Bereits in der ersten Woche darf der «Zimmermann on Tour» bei einem Vorzeigeprojekt, einem Aussichtsturm in Widen (AG), tatkräftig unterstützen. Bis Ende November 2021 ist er mit seinem Camper für den Zimmermannsberuf unterwegs. Fast wöchentlich arbeitet er in einem anderen Holzbaubetrieb und besucht während dieser Zeit Oberstufenklassen und Berufsmessen, um den Schülerinnen und Schülern den Beruf der Zimmerleute näherzubringen.

Auf Wanderschaft zu gehen, hat für die Zimmerleute Tradition. Bereits zum fünften Mal erhält ein junger Zimmermann von Holzbau Schweiz die Chance, als «Zimmermann on Tour» zusätzliche Berufs- und Lebenserfahrung zu sammeln. Benjamin Nussbaum aus dem Kanton Aargau hat sich bei der Auswahl durchgesetzt und wird während den nächsten sieben Monaten in verschiedenen Betrieben seine Fachkenntnisse ausbauen. Während seiner Tour ist er auch Gast und Berichterstatter an Berufswahlmessen und stellt den Oberstufenschülern die Karrieremöglichkeiten im Holzbau vor. Seine Tour startet in Schongau bei der Erni Holzbau AG, wo er bereits an einem Leuchtturmprojekt mitarbeiten darf – dem Hasenbergturm in Widen (AG). Nächste Etappe für Benjamin Nussbaum wird die Tschopp Holzbau AG in Hochdorf im Kanton Luzern sein. Von dort geht er auf direktem Weg ins Tessin zur Firma Veragouth e Xilema in Bedano. Viele weitere Etappen folgen auf seiner Tour mit dem Camper – kreuz und quer durch die Deutschschweiz und das Tessin.
Holzbauunternehmen als Gastgeber
Benjamin Nussbaum kommt aus Densbüren im Kanton Aargau und ist gelernter Zimmermann. Vor drei Jahren hat er seine Lehre abgeschlossen. Auf seiner Tour durch die Schweiz ist er Lernender und Botschafter zugleich. Nebst seinen Einsätzen berichtet er laufend auf Social Media von seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Ob traditionelles Handwerk, moderne Grossprojekte oder Spezialgebiete wie Brückenbau und Treppenbau, zusammen mit dem «Zimmermann on Tour» zeigen die Unternehmen bei denen Benjamin Nussbaum zu Gast ist, welches Potenzial im Holzbau steckt.
Beruf mit Zukunft
Doch was muss jemand mitbringen, der gerne einen Beruf in der Holzbaubranche ergreifen möchte? Es braucht technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Teamfähigkeit. Zimmerleute arbeiten zwar oft draussen, aber eher bei schönem Wetter, da das Holz trocken bleiben sollte. Sägen, fräsen, hobeln, bohren, schrauben und nageln: Beim Bauen mit Holz kommen viele verschiedene Handwerkstechniken zum Einsatz. Aber auch digital kommt einiges hinzu. Früher wurde nur von Hand gezeichnet und manuell produziert, heute gehören CAD und computergesteuerte Fräsmaschinen zu den üblichen Arbeitsinstrumenten mit festem Bestandteil im Lehrplan. Mit den Klimazielen rückt der Holzbau noch mehr ins Zentrum, denn mit Holz lässt sich die CO2-Bilanz eines Gebäudes massiv verbessern. So ganz nebenbei leisten Zimmerleute damit einen aktiven Beitrag an die Umwelt. Kein Wunder also, dass Zimmerleute sehr gefragt sind und sich zahlreiche Junge für den Beruf begeistern.
Von der Walz inspiriert
Andere Regionen kennenlernen, Berufs- und Lebenserfahrung sammeln, das beinhaltet die Tradition der Walz. Auf der Wanderschaft sammeln die Zimmerleute während drei Jahren und einem Tag Berufs- und Lebenserfahrung. Davon inspiriert, startete Holzbau Schweiz 2013 mit «Zimmermann on Tour» erfolgreich eine moderne Variante der Walz. Bereits zum fünften Mal soll jungen Menschen damit der Beruf des Zimmermanns auf zeitgemässe Art nähergebracht werden.
Social Media
Wo Benjamin Nussbaum gerade mit anpackt, erfahren die Interessierten via Social Media.
Facebook: www.facebook.com/zimmermannontour
Instagram: www.instagram.com/zimmermannontour
Snapchat: @zimmermaontour
Unterstützt wird «Zimmermann on Tour» von den Sponsoren: Borm Informatik AG (Computer und Informatik-Tools), Camper Huus (Tourmobil) und Trikora AG (Bekleidung).
Berufsbild und Ausbildung Zimmermann/Zimmerin EFZ
Ein Zimmermann/eine Zimmerin erstellt, renoviert und saniert Holzbauten im Innen- und Aussenbereich. Dazu werden Einzelteile aus Massivholz oder Halbfabrikaten gefertigt und vor Ort montiert. Die Ausbildung dauert vier Jahre. Die theoretischen Grundlagen eignen sich die Lehrlinge in der Berufsschule an, während die praktische Ausbildung in einem anerkannten Holzbaubetrieb erfolgt. Nach erfolgreich bestandener Lehrabschlussprüfung erhält der Auszubildende das eidgenössische Fähigkeitszeugnis. www.lehre-zimmermann.ch
Holzbau Schweiz
Holzbau Schweiz vertritt als Branchenverband rund 900 Holzbaubetriebe (Zimmereien) in der Deutschschweiz und im Tessin. Holzbau Schweiz wahrt die Interessen der Holzbau-Branche gegenüber Staat, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband fördert die unternehmerische und bauliche Qualität der Holzbau-Branche. Er fördert die Aus- und Weiterbildung in der Branche und sorgt für die Durchführung von Berufs- und höheren Fachprüfungen. Zudem unterstützt Holzbau Schweiz die Vernetzung nationaler und internationaler Organisationen. www.holzbau-schweiz.ch