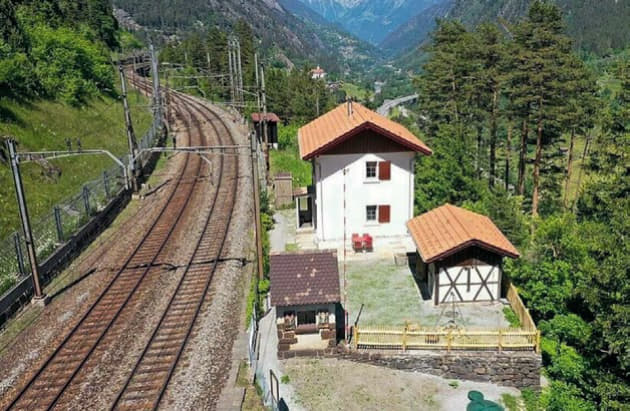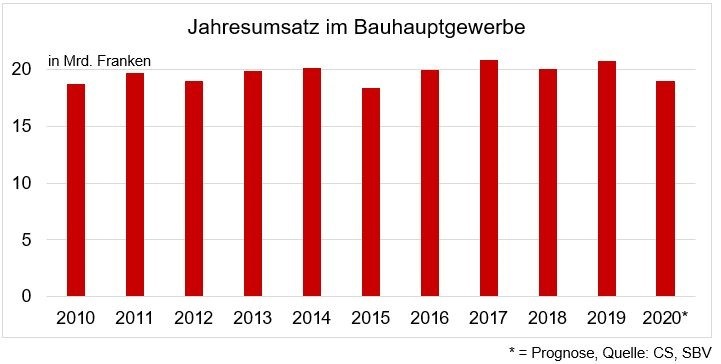Attraktiver Gestaltungsplan für «Breiteli-Areal»
Die Baugenossenschaft Zurlinden, mit Sitz in Zürich, hat sich die 2000-Watt-Gesellschaft auf die Fahne geschrieben. Auf dem Breiteli-Areal, im Dorfkern der Zürcher Seegemeinde Thalwil, lässt sie eine Überbauung mit 35 Wohnungen, Atelier, Kinderkrippe und ebenerdiger Einstellhalle errichten. Mit dem Ziel, an bester Lage preisgünstigen Wohnraum zu schaffen.

Am 9. Dezember 2015 hat die Gemeinde Thalwil ZH an der Gemeindeversammlung dem privaten Gestaltungsplan auf dem Breiteli-Areal zugestimmt. Damit wurde der Weg frei für die Wohnüberbauung Breiteli, mit Fokus auf bezahlbare Mietwohnungen im Zentrum der Gemeinde. Die im Dreieck zwischen der Alten Landstrasse, der Seehaldenstrasse und der Breitelistrasse gelegene Siedlung stammte noch aus den 1920er-Jahren. Der Gebäudebestand auf dem gesamten Areal soll durch teilweisen Rückbau und durch Ersatzneubauten wieder auf den aktuellen Stand gebracht werden, sodass sie wichtige Funktionen in der Entwicklung der Gemeinde Thalwil übernehmen können. Das oberste Ziel ist es, an der gut erschlossenen und attraktiven Lage günstigen Wohnraum anzubieten.
Am 14. April 2016 folgte der Vertragsabschluss mit dem Bauträger, der Baugenossenschaft Zurlinden. Bis zum 23. Mai 2017 wurden die eingegangenen Rekurse abgewiesen und der Gestaltungsplan erlangte Rechtskraft. Darauf folgten die Rückbauarbeiten auf dem Breiteli-Areal, und am 21. August 2018 war die Grundsteinlegung.
Gemäss Mitteilung der Gemeinde Thalwil ZH beinhaltet die Konsenslösung, die im Mitwirkungsverfahren mit der IG Breiteli ausgearbeitet wurde, die Neubauten mit Adresse Breitelistrasse 1, 3 und 5 und eine moderate Sanierung der Bauten in der Breitelistrasse 7 bis 13, 15 bis 21 sowie Hausnummern 23, 25 und 27. Die Sanierung soll die Bausubstanz der Gebäude für weitere 15 bis 20 Jahre erhalten.
Preisgünstig und trotzdem mit allen Vorzügen
Am 14. April 2016 wurde der Baurechtsvertrag notariell beglaubigt. Mit einer Zusatzvereinbarung wurden nach Vorgabe der Gemeinde bereits die Mietzinsberechnung, Vermietungskriterien und die Bewirtschaftung festgelegt. Das Siegerprojekt aus dem Studienauftrag stammt vom Generalplanerteam Saraspiro SA Architektur, Zürich. Ihr Bauprojekt umfasst eine neue Wohnüberbauung an der Breitelistrasse 1 bis 3 auf dem Breiteli-Areal. Die Überbauung ist mit vier Baukuben definiert und weist individuell geschnittene und dreiseitig belichtete Wohnungen mit verschiedenen Grundrisstypen auf. Die Wohnungen sind grundsätzlich behindertengerecht, ein Teil der 2,5-Zimmer-Wohnungen sind rollstuhlgängig, mit Abstellräumen direkt in der Wohnung.
Die Erschliessung dieser 35 Wohnungen ist auf zwei Kerne reduziert. Die Verbindungsbrücken zwischen den Wohnungen liegen komplett im öffentlichen Bereich und vermeiden so Einblicke in den privaten Bereich der Wohnungen. Diese Stege öffnen durch ihre Lage zugleich eine neue Raumebene im Quartier. Eine ebenerdig angeschlossene, rampenfreie Tiefgarage mit angegliederten Nebenräumen vermeidet grosse Erdbewegungen. Die gesamte Überbauung wird gemäss den Vorgaben der 2000-Watt-Gesellschaft realisiert. Die Kellergeschosse und die Treppenhauskerne werden in Ortbeton gefertigt, der Rest wird in Holz bzw. als Holz-Beton-Verbund ausgeführt.
Die Wohnungen je zweier Volumen sind mittels Stegen miteinander verbunden, was zwei Treppenhäuser und zwei Liftanlagen spart. Der umbaute Raum kommt maximal den Wohnungsflächen zugute. Die Wohnungen sind trotz ihrer vordergründig sehr individuellen Ausprägung auf einem klaren Raster aufgebaut und «funktionieren» dank ihrer Flexibilität als Familienheime wie auch für altersgerechtes Wohnen.

Wohnüberbauung Breiteli-Areal Thalwil
Bauherr: Baugenossenschaft Zurlinden, Zürich
Architektur: Saraspiro SA Architektur, Zürich
Baurealisierung: Caretta Weidmann, Team CW 2
Bauzeit: 2018 bis voraussichtlich 2020
Bausumme: CHF 20 Mio.
Rauminhalt nach SIA 416: 16 360 m3
Geschossfläche nach SIA BGF: 5402 m2
Grundstücksfläche: 3170 m2
Energiestandard: 2000 Watt