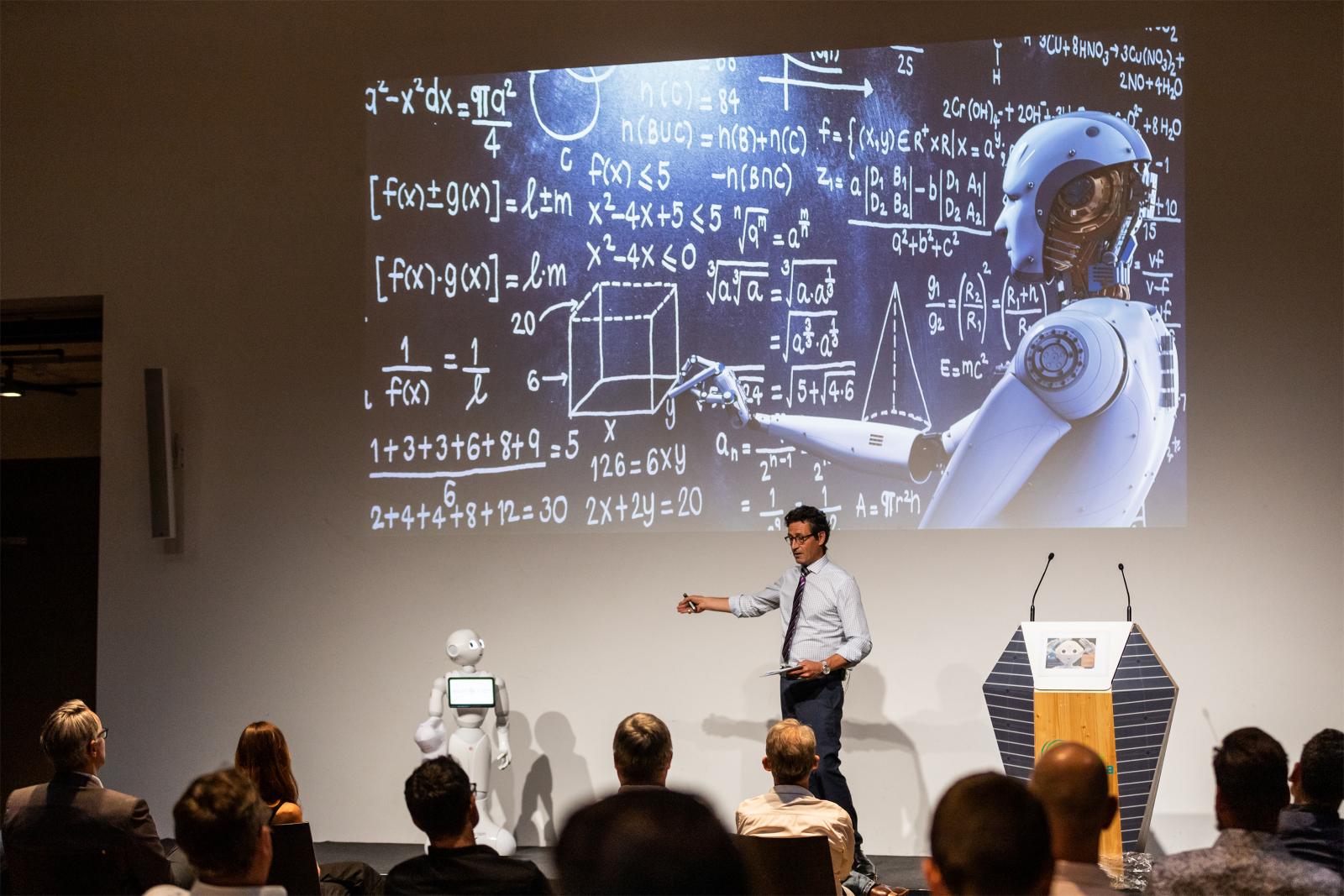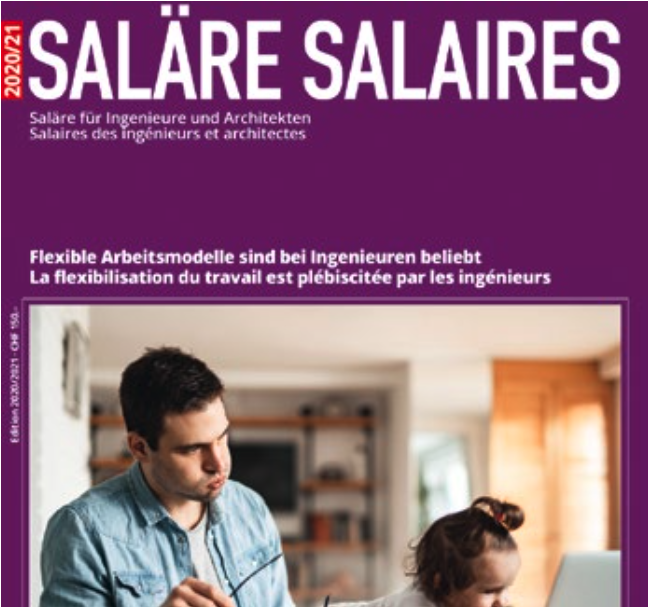Digitalisierung erleichtert die Fairness auf dem Bau
Das Informationssystem Allianz Bau (ISAB) der Bauverbände und Gewerkschaften ist ein Erfolg. Schon bald kommen auf Schweizer Baustellen 10 000 ISAB Cards, die für Fairness sorgen, zum Einsatz. Eine neue ISAB-App erleichtert die Kontrollen.

Wie steht es um das Baukontrollsystem Informationssystem Allianz Bau (ISAB), das 13 Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften Unia, Syna und Bauka-der Schweiz lanciert haben? Diese Frage wollten zahlreichende Medienschaffende beantwortet haben. Sie fanden sich ein zum Point de Presse und erfuhren dort, dass das Baukontrollsystem ISAB in die digitale Offensive gegangen ist. Damit bietet es Kontrollorganen und Bauherren neue Möglichkeiten, GAV-Informationen von Baufirmen und deren Mitarbeitenden direkt auf der Baustelle zu prüfen. So wird eine unvergleichliche Transparenz für alle Beteiligten geschaffen, um den fairen Wettbewerb in der Bauwirtschaft zu stärken.

«Das Informationssystem Allianz Bau (ISAB) verfügt über drei Produkte, welche von den verschiedenen Akteuren genutzt werden. Den Kern bildet die ISAB-Datenbank. In ihr werden von den Paritätischen Kommissionen die Informa-tionen über die Betriebe eingepflegt. Diese Informationen werden von den Paritätischen Kommissionen bearbeitet, weil sie mit der Umsetzung der AVE GAV betraut sind. Auch die Betriebe selbst erfassen in der ISAB-Datenbank die Angaben zu ihren Mitarbeitenden. Aus den Informationen der Paritätischen Kommissionen kann danach die GAV-Bescheinigung generiert werden. Diese liefert Informationen dazu, welchem GAV ein Betrieb unterstellt ist, ob eine Lohnbuchkontrolle gemacht wurde und was deren Ergebnis war», erläuterte Benedikt Koch, Direktor SBV und Vizepräsident ISAB.
Sicheres System
Die neue ISAB-App, die am Point de Presse vorgestellt wurde, ermöglicht es Kontrolleuren, schnell die für sie relevan-ten Informationen aus der Datenbank zu ersehen, um erkennen zu können, ob beim Betrieb in den letzten fünf Jahren eine Lohnbuchkontrolle durchgeführt wurde und ein Verstoss vorliegt oder ob er GAV-konform ist. Auch die für eine Baustellenkontrolle wesentlichen Angaben zum Arbeitnehmer sind auf der ISAB Card hinterlegt. «Die Baustellen-kontrollen sind dank ISAB so digital und transparent wie nie zuvor», freute sich Koch an der Veranstaltung. Das ist in der Tat sehr positiv – wie steht es aber um die Cybersicherheit? Die Verantwortlichen können diesbezüglich alle Bedenken zerstreuen. Für das Login in die ISAB-App wird eine Zwei-Faktor-Authentifizie-rung mit SwissID und ein gültiges Benutzerkonto bei ISAB benötigt. Alle Zugriffe werden festgehalten. Dies entspricht dem Standard, der auch für E-Banking-Anwendungen verwendet wird. Auch der Datenschutz ist gewähr-leistet. Die Funktionalität der ISAB Plattform, der ISAB App und der ISAB Card wurden vorgängig mit Datenschutz-experten seriös abgeklärt. Die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes wurden rechtlich in den ISAB Reglemen-ten und Nutzungsverträgen mit den verschiedenen Nutzergruppen verankert und abgesichert.

Vorteile für KMU und Gross-unternehmen
Die Geschichte des Baukontrollsystems ISAB ist eine erfolgreiche: Schon bald kommen 10 000 ISAB Cards auf Schwei-zer Baustellen zum Einsatz. Roland Dubach, CEO Bau & GU der Anliker AG, zeigte auf, dass die ISAB Card Grossun-ternehmen und KMU Vorteile bietet. «Dank ISAB können wir uns mit der Qualität unserer Leistung von Konkur-renzbetrieben abheben und eine Diffe-renz gegenüber unkorrekten Firmen erreichen» hält Roland Dubach, CEO Anliker AG Bauunternehmung, dazu fest.

Bauherren zeigen Interesse
«Wir erhalten immer wieder Anfragen von Bauherren, welche ISAB in ihre Ausschreibungsunterlagen und Werkver-träge aufnehmen möchten. Innerhalb von ISAB erarbeiten wir Musterformulierun-gen, welche wir dann im persönlichen Gespräch jeweils an die individuellen Bedürfnisse anpassen», berichtete Koch den Journalisten.
Sascha Haltinner, Geschäftsführer des Paritätischen Vereins Informationssystem Allianz Bau (ISAB), erklärte: «Mit nur einem Blick auf die ISAB Card erkennt der Bauherr, ob die betreffende Person bei einem Arbeitgeber angestellt ist, welchen er für Leistungen auf der Baustelle engagiert hat. In den kommen-den Wochen erhalten auch bei ISAB registrierte Vergabestellen Zugang zur ISAB App. Sie können damit die Firmen-zugehörigkeit der Arbeitnehmenden, die Gültigkeit des Ausweises und die aktuelle GAV-Einhaltung der Firma auf der Baustelle schnell und unkompliziert mit dem Handy überprüfen.»
Auch die Bauherren und Vergabestellen wollen vermehrt, dass Unternehmen, welche Tätigkeiten auf ihren Baustellen ausüben, ihre Mitarbeitenden mit ISAB Cards ausrüsten. «Für die Suva als Bauherrin galt schon bisher der Grund-satz, die Vergabe von Aufträgen an die Einhaltung von geltenden Standards zu koppeln», betont Kaspar Lo Presti, Leiter Baumanagement der Suva. «ISAB erleichtert die Überprüfung, welche Firmen sich an die Gesamtarbeits-verträge halten». ■